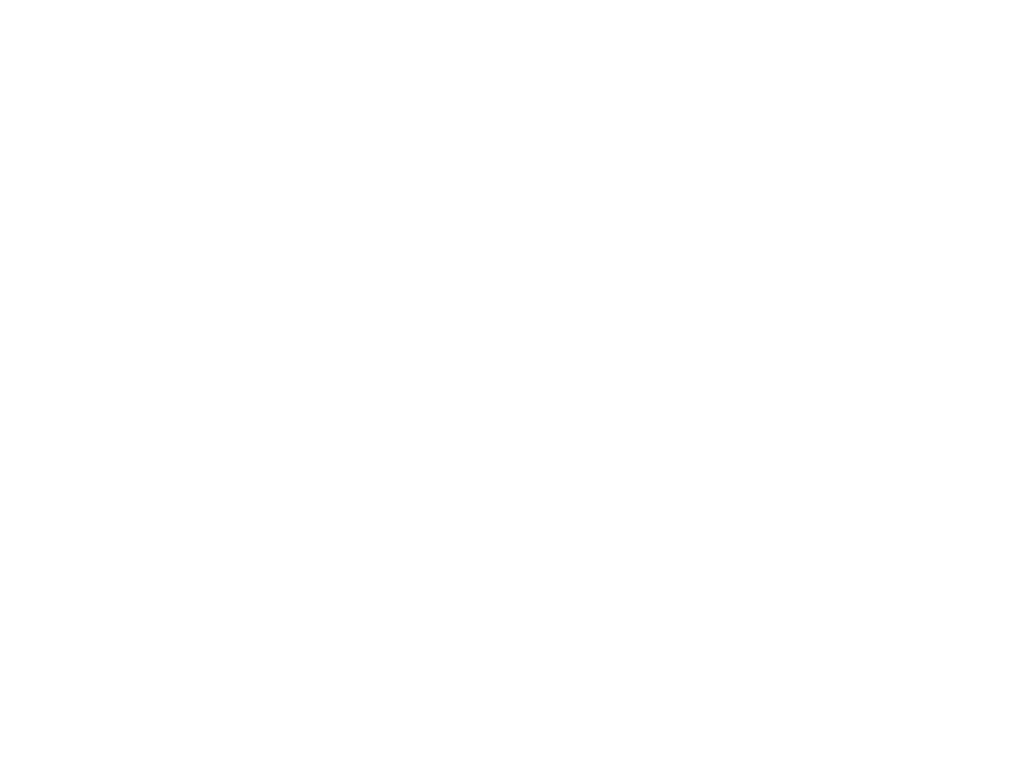

Das am 19. Februar 2013 verkündete Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in der Beschwerde 19010/07 (X und andere gegen Österreich – vgl. LN 1/2013, S. 15 f) hat hohe Wellen in den Medien geschlagen, und auch die HOSI Wien hatte alle Hände voll zu tun, das mediale Interesse zu befriedigen. In ihrer Presseaussendung zeigte sie sich „hocherfreut“ darüber, zumal mit der Adoption eines Stiefkindes ja viele Rechte sowohl des Kindes als auch des Adoptivelternteils verbunden sind.
Im Prinzip hat der Gerichtshof in Straßburg mit dieser Entscheidung seine bereits 2003 durch das Urteil in der Beschwerde Karner gegen Österreich etablierte Rechtsprechung bestätigt, wonach eine rechtliche Unterscheidung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) darstellt [vgl. Aussendung der HOSI Wien vom 24. Juli 2003]. Das erscheint auf den ersten Blick nur konsequent und nachvollziehbar, allerdings stellen die Adoptionsbestimmungen im österreichischen Recht gar nicht auf diese Beziehungen ab.* Die bisherige Unmöglichkeit, dass eine Frau nicht das Kind der Partnerin und ein Mann nicht das Kind des Partners ko-adoptieren konnte, lag nicht an ihrer sexuellen Orientierung, sondern einzig und allein an ihrem Geschlecht, ein Umstand, der auch in anderen Konstellationen zum Tragen kommt und nicht nur in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften.
Bei aller Freude über das Urteil sollten daher einige Facetten im allgemeinen sowie des konkreten Anlassfalles im besonderen – nicht zuletzt im zeitlichen Abstand zur Veröffentlichung des Urteils – auch aus schwul-lesbischer Sicht unvoreingenommen, objektiv und kritisch beleuchtet und angesprochen werden.
Das Adoptionsrecht ist in Österreich im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) geregelt, und dies im wesentlichen ziemlich unverändert seit rund 200 Jahren – dort ist auch nicht von Adoption die Rede, sondern von der „Annahme an Kindesstatt“, wodurch eine „Wahlkindschaft“ entsteht. Es besteht aus 13 Bestimmungen (§§ 191 – 203 ABGB), wobei für die Adoptionsvoraussetzungen gerade einmal die ersten fünf Paragraphen von Bedeutung sind. Ein auf gleichgeschlechtliche Beziehungen ausdrücklich gemünztes Adoptionsverbot – und eine diesbezügliche Diskriminierung –, wie dies in Zusammenhang mit dem Medienhype nach der Verurteilung Österreichs immer wieder kommuniziert wurde, hat es indes nie gegeben, was ja schon historisch erklärbar ist, denn 1812, als das ABGB in Kraft trat, war ja von einer Entkriminalisierung homosexueller Handlungen noch lange keine Rede, geschweige denn von einer wie immer gearteten Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.
Eine Ko- bzw. Stiefkindadoption ist weder für verschiedengeschlechtliche noch für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften extra geregelt, es bestehen dafür keinerlei Sondervorschriften, daher ist ein direkter Gesetzesvergleich zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften in Sachen Adoption gar nicht möglich. Stiefkindadoption fällt – rechtlich gesehen – unter die Adoption durch eine Einzelperson (im Gegensatz zur gemeinsamen Adoption, die Ehepaaren vorbehalten ist).
Und bei der Adoption durch eine Einzelperson ist bisher die Prämisse gewesen, dass ein Wahlvater nur den leiblichen Vater und eine Wahlmutter nur die leibliche Mutter ersetzen kann. Dies hat in der Folge eben dazu geführt, dass in einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft – wie im gegenständlichen Beschwerdefall – die Lebensgefährtin eben nicht an die Stelle des Vaters treten und das leibliche Kind der Partnerin nicht adoptieren konnte. Dies hat aber auch, wie gesagt, andere Konstellationen betroffen, denn Stiefkind- bzw. Ko-Adoptionen finden ja nicht nur unter Paaren statt, die eine sexuelle Beziehung haben, sondern z. B. auch im Familienkreis. Eine Frau kann zum Beispiel nur die Neffen und Nichten eines (verwitweten) Bruders als Wahlkinder annehmen, nicht aber die ihrer (verwitweten) Schwester, weil sie eben als Wahlmutter (und Tante) nicht den (verstorbenen) Vater ersetzen kann und die Kinder ohnehin eine (leibliche) Mutter haben. Ebenso kann ein Onkel als Wahlvater nur an die Stelle des Schwagers, aber nicht der Schwägerin treten.
Bei der Stiefkindadoption ist es bisher eben darum gegangen, dass der fehlende Elternteil durch einen Elternteil ersetzt wird, der das Geschlecht des fehlenden Elternteils hat, und nicht darum, dass irgendeine zweite Person den fehlenden Elternteil ersetzt. Der vom EGMR analog zum Fall Karner herangezogene Vergleich zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften hinkt daher erheblich, da ja überhaupt keine rechtlichen Unterscheidungen getroffen worden sind, sondern neutrale Bestimmungen über die Adoption durch Einzelpersonen eben unterschiedliche Auswirkungen haben. Darin eine Menschenrechtsverletzung zu sehen ist zumindest problematisch.*
Dies scheint letztlich auch dem Gerichtshof aufgefallen zu sein, denn er versucht, seine Entscheidung damit zu rechtfertigen, dass die Beschwerdeführerinnen vor allem deshalb in ihren Menschenrechten verletzt worden seien, als die österreichischen Gerichte – unter Hinweis auf die eindeutige Rechtslage – es angeblich verabsäumt hätten, den Adoptionsantrag des Paares nicht genauso zu behandeln wie jenen eines verschiedenengeschlechtlichen Paares und ihn zumindest sachlich zu prüfen, wobei der EGMR sich ausdrücklich einer Stellungnahme enthält, ob dem Antrag unter den spezifischen Umständen dieses Falls dann auch stattgegeben hätte werden müssen (Randnummer 152 des Urteils). Erschwerend und die Sache zusätzlich verkomplizierend war nämlich bei diesem Fall, dass der leibliche Vater seine Zustimmung zur Adoption verweigert hatte und daher die zuständigen Gerichte zu prüfen gehabt hätten, ob es im Interesse des Kindes gelegen wäre, die verweigerte Zustimmung von Amts wegen zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für eine solche Weigerung vorgelegen wären. Aber auch hier hat sich der EGMR auf dünnes Eis begeben, denn offenbar hat das österreichische Gericht zweiter Instanz diese Frage sehr wohl behandelt oder zumindest gestreift, was der EGMR sogar selber zugeben muss (Randnummer 120 des Urteils), aber eben angesichts der eindeutigen Rechtslage diese in den Vordergrund seiner Begründung gestellt.
In dieser Hinsicht scheint der EGMR auch von seiner üblichen Vorgangsweise abgegangen zu sein, nämlich aufgrund der spezifischen Umstände des konkreten Einzelfalls und nicht abstrakt über eine Gesetzesbestimmung bzw. ihre etwaigen Folgen zu entscheiden. Statt nach der Prämisse zu entscheiden, „auch wenn die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare möglich gewesen wäre, hätte im konkreten Fall die Lebensgefährtin aufgrund der verweigerten Zustimmung des leiblichen Vaters ohnehin nicht adoptieren können, weshalb in diesem konkreten Fall gar keine Menschenrechtsverletzung vorliegen könne“, ist der EGMR der Prämisse gefolgt: „Selbst wenn der Vater seine Zustimmung gegeben hätte, hätte die Lebensgefährtin aufgrund der Rechtslage das Kind der Partnerin nicht als Wahlmutter annehmen können, weshalb eine Menschenrechtsverletzung vorliegt“. Und hier dreht sich die Argumentation im Kreis bzw. landet wieder bei der eigentlichen Grundfrage: Hat der Gesetzgeber das Recht, (Adoptiv-)Elternschaft auf einen Vater und eine Mutter zu beschränken – und das ohnehin unabhängig von der sexuellen Orientierung der Elternteile?
Kulturrevolution
Das Straßburger Urteil kommt jedenfalls einer Kulturrevolution gleich, denn die Konsequenzen sind weitreichend. Es bedeutet einen Paradigmenwechsel, denn es zwingt Österreich dazu, Elternschaft neu zu definieren. Ab nun kann ein Kind rechtlich zwei Mütter und zwei Väter haben – eine Konstellation, die dem österreichischen Kindschaftsrecht völlig fremd ist und die in Hinkunft auch in der Geburtsurkunde der betreffenden Kinder ihren Niederschlag finden müsste. Denn in der Geburtsurkunde eines adoptierten Kindes scheint anstelle des ersetzten Elternteils nur noch der Adoptivelternteil auf. Es finden sich keine Hinweise auf eine Adoption. Eine solche wird nunmehr aber ersichtlich. Man darf schon gespannt sein, wie diese praktischen Auswirkungen von den Behörden und der Verwaltung in Hinkunft gehandhabt werden. Oder wie dann ein ungewolltes „Outing“ der Eltern verhindert werden soll.
Wie sehr man das EGMR-Urteil in seinem Resultat auch begrüßen mag – der Umstand, dass dieses Ergebnis einem souveränen Staat durch einen Gerichtshof im Namen der Menschenrechte aufoktroyiert wird, hinterlässt doch einen fahlen Nachgeschmack. Aus demokratiepolitischer Sicht wäre es jedenfalls besser gewesen, derartige grundlegende und weitreichende gesellschaftspolitischen Fragen politisch zu diskutieren und auch zu entscheiden – und zwar im Parlament, das dafür eigentlich zuständig ist.
Das berührt wieder die Problematik des „Richterrechts“ (vgl. Que(e)rschuss in der letzten LN-Ausgabe (S. 15): Immer mehr im Grunde rein politische Fragen, die demokratisch zu entscheiden wären, werden von nicht demokratisch gewählten HöchstrichterInnen entschieden, weil die Politik versagt. Wie problematisch dies ist, zeigt sich übrigens gerade im vorliegenden Fall. Zum einen wurde das Urteil nur knapp mit zehn gegen sieben Stimmen von der aus 17 RichterInnen zusammengesetzten Großen Kammer des EMGR gefällt – hätten nur zwei anders gestimmt, wäre Österreich nicht verurteilt worden. Es ist wohl mehr als unbefriedigend, dass solche Entscheidungen – Menschenrechtsverletzung oder nicht – mit den oben beschriebenen weitreichenden Konsequenzen mitunter von der Stimme einer einzigen Person in einem relativ kleinen Gremium abhängig sind.
Zum anderen zeigt sich anhand der „abweichenden Meinung“ der sieben RichterInnen, die im gegenständlichen Fall keine Verletzung der EMRK erkennen konnten, wie tiefgespalten die RichterInnen in dieser Frage sind. In ihrer abweichenden Meinung zerreißen diese sieben RichterInnen das Urteil der Mehrheit in der Luft, wobei sie – für ihre Verhältnisse – durchaus untergriffig und polemisch formulieren, was schon in der einleitenden höflichen Killerphrase zum Ausdruck kommt: With all due respect („Bei allem gebotenen Respekt…“)! Selbst als voreingenommener und subjektiver Aktivist muss man ehrlicherweise zugeben, dass diese abweichende Meinung insgesamt überzeugender ist als das Urteil und dessen Begründung durch die Mehrheit.
Wie gesagt, man möge mich nicht (schon wieder) falsch verstehen: Natürlich sollten Gesellschaft und Politik endlich so weit sein, Elternschaft jenseits des Vater-Mutter-Modells rechtlich anzuerkennen und zu ermöglichen. Spätestens, wenn der Zugang lesbischer Paare zu Samenbanken erlaubt wird, ist dies unumgänglich, denn das eine macht ja ohne dem anderen keinen Sinn.
Und da dieser kulturrevolutionäre Paradigmenwechsel nun einmal vollzogen ist, soll er nicht auf gleichgeschlechtliche LebensgefährtInnen beschränkt bleiben, sondern überhaupt für alle prinzipiell möglich sein: Wenn also zwei Frauen bzw. zwei Männer nun einmal gemeinsam Eltern eines Kindes sein können, sollen auch Verwandte und eben alle davon profitieren (was das EGMR-Urteil nicht automatisch zur Folge hat). Für das Kind und sein Wohl ist es ja völlig unerheblich, ob die Eltern auch in einer sexuellen Beziehung zueinander stehen. Die HOSI Wien hat ja immer den Ansatz verfolgt – und dies in ihrem neuen Forderungsprogramm (vgl. S. 4) erneut bestätigt –, die Privilegien heterosexueller Partnerschaften nicht einfach nur auf homosexuelle Partnerschaften auszudehnen, sondern möglichst breite Lösungen für alle zu finden.
Der Weisheit letzter Schluss?
Gerade was die gemeinsame Sorge für Kinder betrifft, sollte Adoption nicht der Weisheit letzter Schluss sein – speziell nicht, wenn es sich um eine lesbische oder schwule Patchworkfamilie (Kind stammt aus einer früheren Beziehung, Familiengründung wird nicht gemeinsam geplant) – handelt. Da gibt es ja andere Möglichkeiten, für Kinder gemeinsam zu sorgen und alle Beteiligten dabei gegen etwaige Widrigkeiten des Lebens abzusichern. Und diese rechtlichen Möglichkeiten gilt es, gegebenenfalls auszubauen. Stiefkindadoption ist jedenfalls dafür überhaupt nicht das Mittel der Wahl, was sich ja bei heterosexuellen Patchworkfamilien zeigt. In Österreich schätzt man die Zahl der Minderjährigen, die in solchen Familien aufwachsen, auf rund 80.000. Die Zahl der jährlichen Stiefkindadoptionen beläuft sich nach Schätzungen indes nur auf rund 300. Es hat sicherlich triftige Gründe, warum die allermeisten Stiefmütter und Stiefväter in solchen Patchworkfamilien von einer Adoption absehen. Und auch lesbische Frauen (und schwule Männer) sollten sich der Risiken bewusst sein und nicht in diese Falle tappen: Die Chance, dass die Beziehung zerbricht, steht statistisch ja bei 50 : 50. Nach dem Scheitern der Beziehung ist man möglicherweise froh, das leibliche Kind der Partnerin/des Partners, das diese/r nach der Trennung dann in eine neue Beziehung mitnimmt, nicht adoptiert zu haben…
Skurrile Auseinandersetzung
Im übrigen war die massenmediale Diskussion, die dem Bekanntwerden der Straßburger Entscheidung folgte, zum Teil höchst skurril – und auch äußerst ärgerlich, weil sie ausgerechnet von einem Teil der Lesben- und Schwulenbewegung ohne Not vom Zaun gebrochen wurde: Der Umstand, dass sich Politik und Gesellschaft dagegen wehren, dass ein Kind rechtlich zwei Mütter bzw. zwei Väter hat, wurde – entgegen aller Fakten und der alltäglichen Realität – damit gleichgesetzt, Politik und Gesellschaft hielten Lesben und Schwule für ungeeignete Eltern. Das ist eine unzulässige Vermischung, denn davon kann ja überhaupt keine Rede sein: Niemand hat je ernsthaft zwei Lesben bzw. zwei Schwule daran gehindert, gemeinsam Kinder großzuziehen; es kommt sicherlich auch tausendfach in Österreich vor. Kein Jugendamt hat Lesben oder Schwulen, die ein eigenes Kind mit der/dem gleichgeschlechtlichen Partner/in gemeinsam aufziehen, das Kind abgenommen. Lesbische und schwule Paare werden in mehreren Bundesländern von den Jugendämtern als Pflegeeltern eingesetzt. Und das Gesetz (!) über die eingetragene Partnerschaft stellt sogar ausdrücklich eine rechtliche (!) Grundlage für die Existenz von Regenbogenfamilien dar, denn es sieht vor, dass man als Einzelperson – mit Zustimmung der Partnerin/des Partners – ein Kind adoptieren und dann gemeinsam großziehen kann.
Selbsterfüllende Stigmatisierung
Angesichts dieser Fakten von schwul-lesbischer Seite zu argumentieren, Staat, Politik und Gesellschaften wollten uns das Erziehen von Kindern verbieten, weil sie uns als schlechte Eltern betrachten, ist hochgradig grotesk. Man rieb sich die Augen, dass sich plötzlich GegnerInnen und BefürworterInnen entsprechende Studie um die Ohren warfen, die den jeweiligen Standpunkt untermauern sollten. Die einsetzende Diskussion war völlig überflüssig, irrelevant, kontraproduktiv, eine totale Themenverfehlung und lud höchstens total uninformierte Dumpfbacken aus der FPÖ ein, genau in diese Kerbe zu schlagen – als hätten Politik oder Behörden jemals die Eignung von Lesben und Schwulen, Kinder großzuziehen, ernsthaft in Frage gestellt! Ein klarer Fall von „selbsterfüllender Stigmatisierung“.
Nach dem EGMR-Urteil ist nun die bizarre Situation eingetreten, dass nichteingetragene PartnerInnen mehr Rechte haben als eingetragene. Entsprechende rechtliche Änderungen im EP-Gesetz sind zwar nicht zwingend bzw. automatisch aus dem Urteil abzuleiten, aber natürlich wäre es abwegig vom Gesetzgeber, hier untätig zu bleiben und es auf eine neuerliche Verurteilung aus Straßburg ankommen zu lassen. Justizministerin Beatrix Karl hat jedenfalls angekündigt, das im EP-Gesetz (§ 8 Abs. 4) ausdrücklich vorgesehene Verbot der Stiefkindadoption zu streichen, was natürlich mit der Beseitigung aller Ungleichbehandlungen in direkt damit zusammenhängenden Gesetzesmaterien – hier handelt es sich vor allem um finanzielle, pensions- und sozialversicherungsrechtliche Vorteile – einhergehen muss.
Zugleich hat Karl aber auch festgehalten, die gemeinsame Fremdkindadoption durch ein gleichgeschlechtliches Paar – egal, ob in einer Lebensgemeinschaft oder EP lebend – nicht ermöglichen zu wollen. Die gemeinsame Fremdkindadoption solle weiterhin Ehepaaren vorbehalten bleiben. Hier wird die HOSI Wien ihr Lobbying jedoch fortsetzen.
* Nachträgliche Anmerkung:
Der EGMR hatte ein Jahr zuvor, im März 2012, eine französische Beschwerde in Sachen Stiefkindadoption durch ein gleichgeschlechtliches Paar negativ beschieden. In dieser Rechtssache hatte er sich ebenfalls darauf beschränkt, die Situation von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren zu vergleichen. Und in Frankreich sah der Pacs, die französische Version der eingetragenen Partnerschaft, eben weder für gleich- noch verschiedengeschlechtliche Paare eine Stiefkindadoption vor. Insofern war der EGMR konsequent.
Die LN 2/2012 (S. 34) berichteten über diesen Fall: Valérie Gas und Nathalie Dubois lebten seit 1989 zusammen. Im September 2000 gebar eine der Frauen nach einer künstlichen Befruchtung in Belgien mit dem Samen eines anonymen Spenders ein Mädchen. Zwei Jahre später ging das Paar einen Pacs ein. Im Jahre 2006 stellte die (nicht-leibliche) Co-Mutter einen Antrag auf Stiefkindadoption. Die französische Justiz lehnte dies unter Hinweis auf das geltende Familienrecht ab. Diesem zufolge sei nur in einer Ehe eine Stiefkindadoption möglich. Es handle sich dabei um keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, da ein verschiedengeschlechtliches Paar, das einen Pacs geschlossen habe, ebenfalls kein Recht auf Stiefkindadoption habe. Die Klägerinnen hatten in diesem Zusammenhang auch argumentiert, ihnen werde in Frankreich eine Heirat verwehrt. Dazu stellte der EGMR jedoch wie bereits in seinem Urteil in der Beschwerde Schalk & Kopf gegen Österreich (vgl. LN 3/2010, S. 19 f) fest, dass die Europäische Menschenrechtskonvention kein Recht auf Ehe für gleichgeschlechtliche Paare vorsehe. In dieser Frage verfüge jeder Staat über einen gewissen Ermessensspielraum.