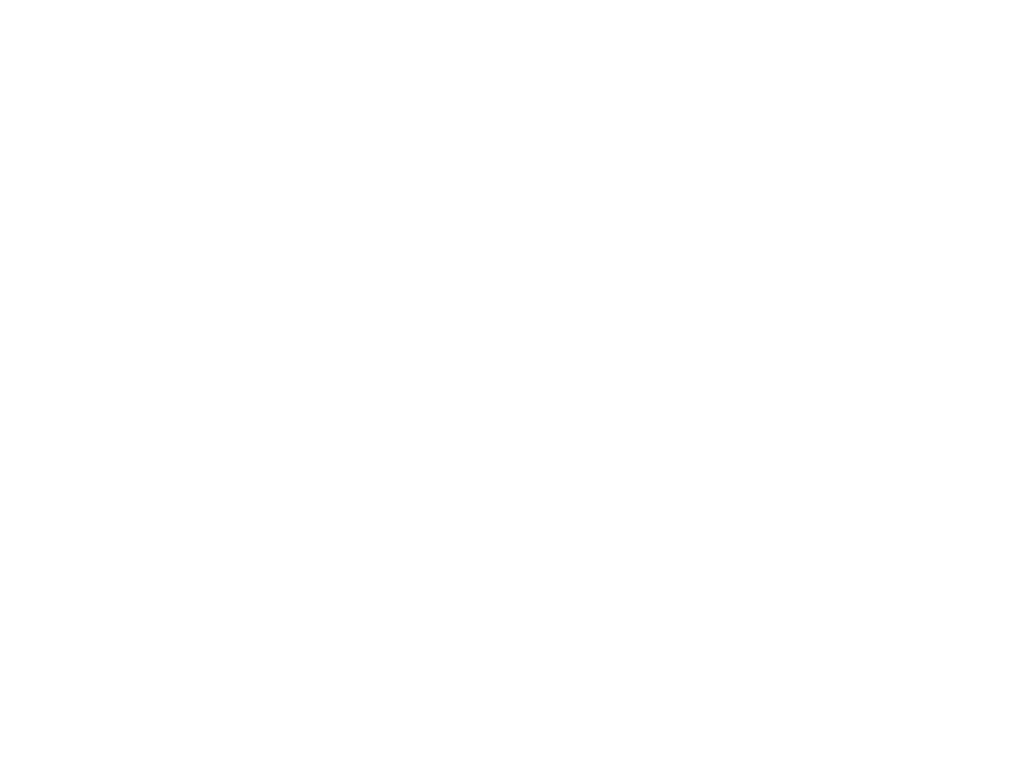

Am 11. Dezember 2015 hat die EU-Kommission eine Europäische Bürgerinitiative zur Definition von Ehe und Familie für die Zwecke des EU-Rechts registriert (im englischen Original lautet sie „Mums, dads and kids – European Citizens’ Initiative to protect Marriage and Family“. Das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) wurde mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt. Seit dem Inkrafttreten der EBI-Verordnung im April 2012 haben die BürgerInnen die Möglichkeit, ein bestimmtes Thema auf die politische Tagesordnung der Kommission setzen zu lassen. Unterstützt mindestens eine Million BürgerInnen aus mindestens einem Viertel der EU-Mitgliedsstaaten eine formell registrierte Initiative, so können sie die Kommission ersuchen, in ihren Zuständigkeitsbereichen einen Rechtsakt vorzuschlagen. Nur wenn eine registrierte Bürgerinitiative eine Million gültige Unterstützungsbekundungen aus mindestens sieben Mitgliedsstaaten erhält, muss die Kommission entscheiden, ob sie tätig wird oder nicht, und die Gründe für ihre Entscheidung erläutern.
Mit der nun registrierten EBI wird die EU-Kommission aufgefordert, einen Vorschlag für eine Rechtsvorschrift zu unterbreiten, mit der die Ehe als eine Verbindung von Mann und Frau und die Familie als eine auf Ehe und/oder Abstammung gründende Verbindung für die Zwecke des EU-Rechts definiert werden soll. Mit dieser Registrierung haben die OrganisatorInnen nun ein Jahr Zeit, Unterschriften zur Unterstützung der geplanten Bürgerinitiative zu sammeln. Die Entscheidung der Kommission zur Registrierung der Initiative betrifft ausschließlich die rechtliche Zulässigkeit des Vorschlags. Nach Maßgabe der EBI-Verordnung gelten folgende Zulässigkeitsvoraussetzungen: Die geplante Initiative liegt nicht offenkundig außerhalb des Rahmens, in dem die Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt vorzulegen, sie ist nicht offenkundig missbräuchlich, unseriös oder schikanös und sie verstößt nicht offenkundig gegen die Werte der Union.
Das Kollegium der Kommissionsmitglieder erörterte die rechtliche Zulässigkeit der vorgeschlagenen Bürgerinitiative am 9. Dezember und kam zu dem Schluss, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Registrierung der Initiative erfüllt sind. Das Kollegium hat den Inhalt der Initiative zum jetzigen Zeitpunkt nicht untersucht. Sollte die Bürgerinitiative innerhalb eines Jahres eine Million Unterstützungserklärungen aus mindestens sieben verschiedenen Mitgliedsstaaten erhalten, muss die Kommission innerhalb von drei Monaten reagieren. Die Kommission kann entscheiden, der Aufforderung zu folgen oder ihr nicht zu folgen; in beiden Fällen muss sie ihre Entscheidung begründen.
Die Zulassung dieser EBI kam für viele überraschend, und die Enttäuschung bei den GegnerInnen, darunter natürlich auch in der LSBT-Bewegung, war entsprechend groß. Sie argumentieren, hier sei eine EBI registriert worden, die eindeutig außerhalb des Rahmens liege, in dem die Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt vorzulegen, denn in Sachen Familienrecht verfüge Brüssel ja über keinerlei Zuständigkeit, diese liege bei den Mitgliedsstaaten. Eine Beschwerde gegen die Zulassung dieser EBI ist daher in Vorbereitung.
Hier hat die LSBT-Bewegung allerdings ein Argumentations- bzw. Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie selbst von der EU-Kommission Verordnungen bzw. Rechtsakte einfordert, die das Ehe- bzw. Familienrecht betreffen und daher nicht in die Kompetenz Brüssels fallen (vgl. ULRIKE LUNACEKs Kolumne auf S. 31), nämlich in Hinblick auf die Anerkennung von in einem EU-Mitgliedsstaat geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehen und eingetragenen Partnerschaften (EP) in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten, ungeachtet, ob diese dieselben oder ähnliche Rechtsinstitute in ihrem nationalen Recht haben oder nicht. Begründet wird das mit dem nicht wirklich stichhaltigen Argument, diese Nichtanerkennung schränke das Recht der EU-BürgerInnen auf Niederlassungsfreiheit und Freizügigkeit innerhalb der EU ein.
Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sich jene Länder, die diese Rechtsinstitute nicht haben und nicht daran denken, sie einzuführen, allen voran Polen, sich gegen eine solche EU-weite Anerkennung wehren und sie sicherlich zu verhindern wissen. Denn in der Praxis müsste diese Regelung dann auch für die eigenen StaatsbürgerInnen gelten. Wenn diese jedoch einfach nur ins benachbarte Ausland zu fahren brauchen, um dort gleichgeschlechtlich zu heiraten, und dann in ihrem Heimatland als Ehepaar anerkannt werden müssten, ja dann bräuchten die nationalen Parlamente erst gar nicht mehr über die Einführung der Homo-Ehe oder EP befinden. Dann hätte sich das durch diese Hintertür erledigt. Jedes nationale Parlament, das noch einen Funken Selbstachtung hat, wird sich gegen eine derartige Entmachtung durch Brüssel zur Wehr setzen. Und dafür hat sogar der Autor dieser Zeilen vollstes Verständnis (vgl. LN 2/2014, S. 10 f).
Das Argument, dass durch diese Nichtanerkennung das Recht auf Freizügigkeit unrechtmäßig eingeschränkt werde, trifft – wie gesagt – nicht zu, denn es handelt sich ja dabei um kein absolutes Recht, sondern es unterliegt nicht nur faktischen und praktischen, sondern auch zahlreichen rechtlichen Einschränkungen, wovon ja nicht zuletzt die aktuellen Debatten über den Ausschluss ausländischer EU-BürgerInnen von der Gewährung von Sozialleistungen in Großbritannien oder eine neuerliche Abschottung des österreichischen Arbeitsmarkts wegen der hohen Arbeitslosigkeit unter im Land lebenden EU-BürgerInnen zeugen.
Niemand kann nationale Privilegien und Rechte unter Berufung auf die Freizügigkeit in ein anderes EU-Land mitnehmen. Das gilt etwa auch fürs Steuer- oder Strafrecht. So kann beispielsweise ein Österreicher, der seine sexuellen Bedürfnisse nur mit Prostituierten befriedigt, bei einer Übersiedlung nach Schweden auch nicht unter Berufung auf sein Recht auf Freizügigkeit auf eine Ausnahme von der Kriminalisierung der Freier durch das schwedische Prostitutionsverbot pochen. Und umgekehrt wird etwa ein dänischer Neo-Nazi sich nicht erfolgreich darauf berufen können, dass daheim NS-Propaganda unter die Meinungsfreiheit fällt und nicht strafbar ist und er folglich in seinem Recht auf Freizügigkeit eingeschränkt werde, weil er sich in Österreich nicht niederlassen kann, ohne für nationalsozialistische Betätigung strafrechtlich verfolgt zu werden.
In der Frage der EU-Kompetenz in Sachen Familienrecht sollten die LSBT-Bewegung und ihre politischen Verbündeten daher nicht mit zweierlei Maß messen und redlicher argumentieren. So sehr es manche auch bedauern mögen: Ehe- und Familienrecht fällt nicht unter die Zuständigkeit der EU, die EP bzw. Homo-Ehe muss auf nationaler Ebene erkämpft werden.