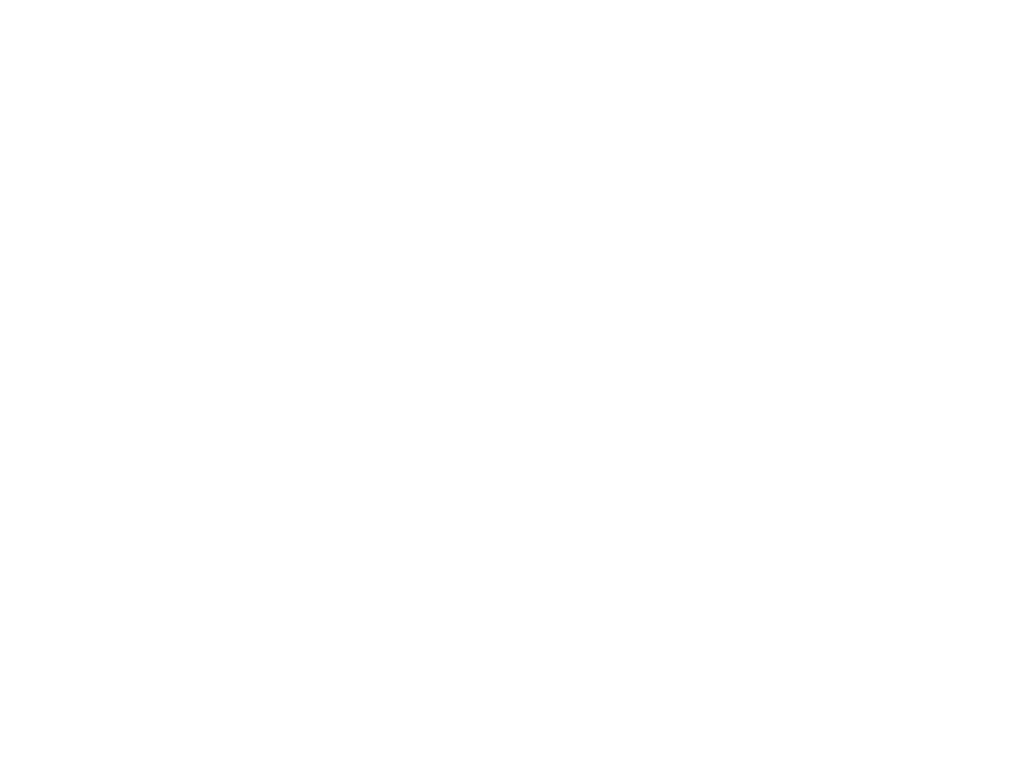

Als Europa noch geteilt war, hatten die kommunistischen Staaten als Pendant zur Eurovision ihre Intervision. Aufgrund des Televoting beim Eurovisions-Songcontest wird er immer mehr zu einem Intervisions-Songcontest: Beim diesjährigen Festival in Helsinki kamen neun der zehn Beiträge, die vom Semifinale ins Finale aufstiegen, aus Osteuropa. Der zehnte war der türkische. Im Finale waren unter den zehn besten, die sich damit für einen Fixstart im nächsten Jahr qualifizierten, außer Griechenland und der Türkei ebenfalls nur osteuropäische Länder. Sollte es im nächsten Jahr bei der Vorausscheidung ähnlich zugehen, würden in Belgrad dann von den 24 Finalisten 18 „Intervisions“-Länder sein. Das wird dann wohl der Anfang vom Ende des Songcontest sein.
Leider hat diese Entwicklung gar nichts mit der Qualität der Lieder zu tun, sondern hängt ausschließlich mit dem patriotischen Abstimmungsverhalten der MigrantInnen und Volksgruppen in den jeweiligen Ländern zusammen. Keineswegs liegt es daran, dass sich Nachbarländer gegenseitig die Stimmen zuschieben würden, wie oft unrichtigerweise behauptet wird. Dass Serbien zwölf Punkte von Bosnien-Herzegowina bekommen hat, bedeutet nicht, dass die Bosnier ihre Nachbarn so lieben und ihnen die Massaker in Srebrenica und anderen Orten verziehen hätten, sondern dass mit der Republika Srpska ganz einfach bedeutendes serbisches Kernland auf bosnischem Territorium liegt.
Die Televoting-Ergebnisse beim Songcontest spiegeln Migrationsströme und die Größe nationaler Minderheiten in den einzelnen Ländern besser als jede diesbezügliche europaweite Studie wider. Seit Televoting in Österreich praktiziert wird, ist Serbien auf die 12 Punkte aus Österreich abonniert, egal wie gut oder schlecht das Lied ist. Da fährt die Eisenbahn drüber – weil eben die Serben die stärkste Einwanderergruppe in Österreich ausmachen – gefolgt von Türken und Bosniern. Ähnliche Muster gelten für die Schweiz, Deutschland und die Niederlande. Aber nicht nur die klassischen Gastarbeiterströme lassen sich leicht nachvollziehen, auch die ganz modernen: Die portugiesische Bau- und Landwirtschaft ist heute fest in der Hand hunderttausender Moldawier und Ukrainer. Kein Wunder, dass Portugal heuer zehn Punkte an Moldawien und zwölf an die Ukraine vergab. Spanien, das üblicherweise die zwölf Punkte aus dem iberischen Nachbarland bekommt, musste sich mit acht Punkten begnügen. Dass Dublin heute die zweitgrößte lettische Stadt ist, fand in Helsinki ebenfalls seinen Niederschlag: zehn Punkte aus Irland für Lettland. Die einzige Neuigkeit in dieser Hinsicht war zu erfahren, wie die armenische Diaspora über Europa verstreut ist. Und solange die halbe Bevölkerung Estlands aus ethnischen Russen besteht, werden Estlands zwölf Punkte immer an Russland gehen.
Analysiert man die Vergabe der 8, 10 und 12 Punkte in Helsinki durch die 42 Länder (insgesamt also 126 Voten) unter diesen Prämissen, sind vielleicht gerade einmal 15 Punktevergaben nicht vorhersehbar gewesen, darunter die hohen Punkte für Ungarn aus allen fünf nordischen Staaten (aber das ungarische Lied war auch eines der besten), die zwölf von Albanien an Spanien oder die zehn von Malta an Belarus. Der Rest war indes anhand des oben skizzierten Schemas wenig überraschend.
Angesichts von 42 teilnehmenden Ländern kann natürlich kein Lied nur mit den Stimmen seiner GastarbeiterInnen, MigrantInnen oder Volksgruppen in anderen Ländern gewinnen, aber es geht ja nicht nur um die ersten, sondern schließlich auch um die hinteren Plätze. Der ukrainische Beitrag, offenbar eine weitere Spätfolge des Reaktorunglücks in Tschornobyl, wäre ohne das unfaire Televoting wohl genauso wenig so weit vorne gelandet wie der türkische 08/15-Beitrag. Aus Ländern ohne große türkische Community, etwa Andorra, Belarus, Estland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowenien oder Tschechien, gab es – zu Recht – null Punkte für Kenan Doğulus Shake it up şekerim.
Keine Frage: Marija Šerifović hat mit ihrer mit viel Inbrunst vorgetragenen Ballade, die wohl auch ganz nach dem Geschmack vieler schwuler Grand-Prix-Aficionados ist, verdient gewonnen – nicht nur, weil sie lesbisch ist. Erfreulich auch, dass man nicht unbedingt englisch singen muss, um zu gewinnen. Aber dennoch bleibt ein sehr schaler Nachgeschmack…